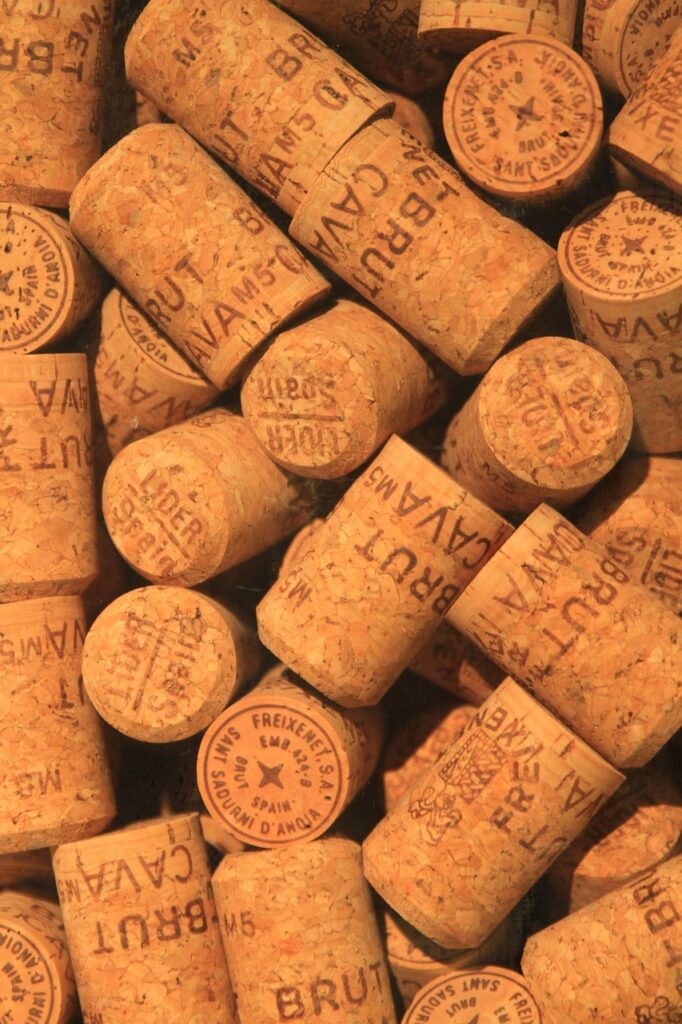Ein Stück Natürlichkeit
Bodenbeläge aus Kork
Lassen Sie Ihren Kork-Bodenbelag vom Fachhandwerk verlegen. Mit Feist-Böden liegen Sie auf der richtige Seite.
Es gibt verschiedene Arten der Korkoberfläche bei Fußbodenbelägen: einerseits die einschichtigen Presskork-Korkbeläge und andererseits die furnierten, mehrschichtigen Bodenbeläge. Die furnierten Korkbodenbeläge unterscheiden sich durch ein aufgeklebtes Korkfurnier von den einschichtigen Presskork-Korkplatten. Massiven Kork gibt es bisher nur als Korkmosaik. Das Furnier wird auf den Presskork-Korkbelag geklebt und dient in erster Linie dekorativen Zwecken. Ein weiterer Vorteil ist die bessere Farbdeckung bei eingefärbten Korkplatten. Der Nachteil furnierter Korkfliesen ist die schlechtere Abriebfestigkeit. Diese kann jedoch mit Siegellack deutlich verbessert werden, so dass die Abriebfestigkeit beinahe die massiver Korkbeläge und Presskork-Korkplatten erreicht. Neben stark lösungsmittelhaltigen Siegellacken auf Polyurethanbasis werden seit 2002 teilweise auch umweltfreundlichere Siegellacke auf Wasserbasis angeboten.
Herkömmliche Korkfliesen und herkömmliches Kork-Fertigparkett bestehen aus Korkgranulat, was in verschiedenen Verfahren mit Bindemitteln gemischt und gepresst wird.
Die Hersteller verkaufen Korkparkett als Fliesen, welche sich vollständig mit dem Untergrund verkleben lassen, und Kork-Fertigparkett, welches mit Nut-und-Feder-Systemen schwimmend verlegt, also nicht mit dem Untergrund verklebt wird. Ganz ohne Klebstoff beim Verlegen kommen Korkparkettsysteme mit speziellen Verbindungen zwischen den Fliesen (Klick-Systeme) aus. Seit 2001 gibt es Korkmosaik, dieses besteht aus massiven Korkstücken (kein Granulat mit Bindemittel) und ist ähnlich wie Steinmosaik auf einem Trägermaterial vorgefertigt. Es wird vollflächig verklebt und nachträglich wie Steinfliesen ausgefugt. Die Oberflächenbehandlung kann ähnlich wie bei Klebekork und Kork–Fertigparkett dem Verwendungszweck angepasst werden. Der Vorteil von massivem Korkmosaik liegt in der erweiterten Anwendung für Außenbereiche und in Nasszellen.

Welcher Baum liefert Kork?
Als Kork wird in der Botanik die Zellschicht zwischen Epidermis und Rinde bezeichnet. Im Alltagsgebrauch wird mit dem Begriff Kork das Material aus der Rinde der Korkeiche (Quercus suber) bezeichnet, aus dem vor allem Korken gewonnen werden. Kork wird zudem aus der Borke des asiatischen Amur-Korkbaums (Phellodendron amurense) gewonnen. Weltweit größter Korkproduzent ist Portugal, Weltmarktführer ist das portugiesische Unternehmen Corticeira Amorim.
Feist Böden
einfach gut
Wissenswertes zu Kork
Bodenbeläge aus Korken
Werden Flaschenkorken wiederverwendet? Wie es industriell funktioniert und warum es so sinnvoll ist:
- Sammeln und Zerkleinern: Die gesammelten Naturkorken (wichtig: nur Naturkork, keine Kunststoffkorken oder Korken mit Anhaftungen!) werden zerkleinert und zu Korkgranulat verarbeitet.
- Pressen und Binden: Dieses Granulat wird dann unter hohem Druck und mit Bindemitteln (idealerweise Naturharzen, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten) zu Platten oder Rollen gepresst.
- Veredelung: Diese Platten oder Rollen können dann weiterverarbeitet werden, z.B. zu Klick-Korkböden oder als Unterlagsmaterial.
Dieses Recycling ist sehr nachhaltig und sinnvoll, da Kork ein wertvoller, nachwachsender Rohstoff ist. Aus den recycelten Korken werden nicht nur Bodenbeläge, sondern auch Dämmstoffe für Häuser, Einstreu für Tiere oder sogar Infill für Kunstrasenplätze hergestellt.
Lebensdauer von Kork
Die Lebensdauer eines Korkbodens hängt von verschiedenen Faktoren ab, aber bei normaler Beanspruchung und guter Pflege können Sie von einer Haltbarkeit von 15 bis 20 Jahren ausgehen. Hier sind die wichtigsten Punkte, die die Lebensdauer beeinflussen:
- Qualität des Korkbodens: Hochwertige Korkböden, insbesondere solche mit einer dicken Nutzschicht und einer guten Verarbeitung, halten länger als günstigere Varianten.
- Art der Versiegelung:
- Versiegelte Korkböden (lackiert): Diese sind in der Regel widerstandsfähiger gegen Abrieb und Feuchtigkeit. Die Lackschicht muss jedoch alle paar Jahre (oft 5-10 Jahre, je nach Beanspruchung) erneuert werden, um den Schutz aufrechtzuerhalten.
- Geölte oder gewachste Korkböden: Sie bieten ein natürlicheres Gefühl und lassen sich punktuell reparieren, erfordern aber eine regelmäßige Auffrischung der Oberfläche (oft jährlich oder alle paar Jahre), um ihren Schutz zu bewahren.
- Beanspruchung: Ein Korkboden im stark frequentierten Flur oder in der Küche wird naturgemäß schneller Verschleißerscheinungen zeigen als ein Boden im Schlafzimmer oder Gästezimmer.
- Pflege: Regelmäßiges Kehren oder Staubsaugen und nebelfeuchtes Wischen sind essenziell. Wichtig ist, den Boden nicht zu nass zu wischen, da übermäßige Feuchtigkeit Kork aufquellen lassen kann. Auch der Schutz vor Kratzern durch Filzgleiter unter Möbeln und das Vermeiden von Steinchen oder Sandpartikeln auf dem Boden tragen zur Langlebigkeit bei.
- Sonneneinstrahlung: Direkte, intensive Sonneneinstrahlung kann dazu führen, dass der Korkboden mit der Zeit ausbleicht. Spezielle UV-Schutzversiegelungen können hier Abhilfe schaffen.
- Möglichkeit des Abschleifens: Einige Korkböden, insbesondere solche mit einer dickeren Oberflächenschicht, können wie Parkett abgeschliffen und neu versiegelt werden. Dies kann die Lebensdauer deutlich verlängern und dem Boden ein neues Aussehen verleihen.
Verglichen mit Parkett (das bei guter Pflege und mehrmaligem Abschleifen oft 30-50 Jahre oder länger halten kann) ist die Lebenserwartung eines Korkbodens etwas kürzer. Dennoch ist er ein sehr langlebiger und robuster Bodenbelag, der durch seine natürlichen Eigenschaften (Wärme, Elastizität, Trittschalldämmung) viele Vorteile bietet.